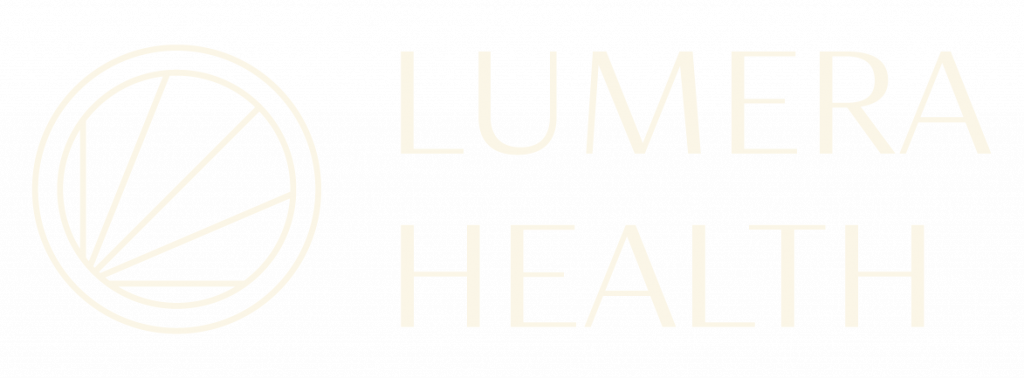Wenn das „Tun“ sich wie ein Berg anfühlt
Du weißt eigentlich, was zu tun wäre. Vielleicht sogar, warum. Aber Dein Körper bleibt sitzen. Dein Kopf schweift ab. Und Du denkst: Wieso krieg ich das nicht hin? Obwohl Du motiviert bist, fühlst Du dich blockiert, oder überfordert. Willkommen in der Welt der Prokrastination – dem psychologischen Phänomen, wichtige Aufgaben aufzuschieben, obwohl man es eigentlich besser weiß. Doch hinter dem Aufschieben steckt kein Faulheitssymptom, sondern oft ein Überlastungsschutz des Gehirns.
Warum wir aufschieben: ein Blick ins Gehirn
Neuropsychologisch betrachtet entsteht Aufschieben oft dann, wenn unser präfrontaler Kortex (Zuständig für Planung, Steuerung, Entscheidungen) von emotionalem Stress überlagert wird. Das führt zu:
- Blockade
- innerer Unruhe
- oder kompletter Erschöpfung
In diesem Zustand priorisiert das Gehirn lieber kurzfristige Entlastung (z. B. Social Media, Aufräumen, Rückzug), als sich mit der gefühlt bedrohlichen Aufgabe auseinanderzusetzen.
Quelle: Sirois, Melia, & Pychyl (2019). Procrastination, stress, and chronic health conditions: A temporal perspective. Journal of Behavioral Medicine.
Was wirklich hilft:
Nicht „sich zusammenreißen“, sondern Runterfahren und Struktur geben. Statt Dich weiter zu kritisieren, brauchst Du ein System, das Dein Nervensystem beruhigt, Deine Aufgaben entschärft und den Einstieg niedrig schwellig macht. Und genau das leistet die folgende Methode:
Die Drei-Schritte-Methode gegen Aufschieberitis
1. Stopp. Spüren. Senken.
Bevor Du loslegst, halte kurz inne. Frage dich:
- Was ist gerade mein innerer Zustand?
- Was stresst mich an dieser Aufgabe?
Dann, ohne Bewertung, nimmst Du Deinen Körper mit:
- 2 Minuten bewusst atmen (4 Sek. ein / 6 Sek. aus)
- Bewegung: Schultern kreisen, Hände schütteln, aufstehen
- Laut aussprechen: „Ich bin überfordert, doch ich darf klein anfangen.“
Ziel: Den Stressimpuls entkoppeln, bevor Du versuchst, ins Tun zu kommen.
Quelle: Bessel van der Kolk (2014). The Body Keeps the Score – Körperwahrnehmung reguliert Stress.
2. Mikroschritt definieren
Große Aufgaben wirken wie ein Berg – unser Gehirn blockt. Zerlege deshalb Deine Aufgabe in einen Mini-Schritt, der in 5 Minuten machbar ist. Beispiel:
- Statt „Steuer machen“ → „Ordner öffnen und 1 Beleg raussuchen“
- Statt „Website überarbeiten“ → „Headline überprüfen“
- Statt „Bewerbung schreiben“ → „Vorname in Lebenslauf ändern“
Frage Dich: Was ist der kleinste nächste Schritt, den ich mir selbst wirklich zutraue?
Dann tu genau das. Und nur das.
Quelle: Fogg, B. (2019). Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything.
3. Nachspüren & verstärken
Nach dem Mikroschritt: Nimm bewusst wahr: Ich habe begonnen. Sage Dir innerlich (gern laut): „Ich bin ins Handeln gekommen.“
Diese bewusste Verstärkung ist entscheidend, denn sie stärkt die neuronale Verknüpfung von: Tun = Erfolgserlebnis statt Druck. Und genau das verändert Deine Gewohnheitsstruktur – langfristig.
Quelle: Duhigg, C. (2012). The Power of Habit – Belohnung verstärkt Verhalten.
Fazit: Du musst nicht alles schaffen. Nur anfangen.
Handeln beginnt nicht mit Motivation, sondern mit Selbstberuhigung + Mikroschritt + Belohnung.
Wie belohnst Du Dich, nachdem Du diesen Text gelesen hast?
Wie wirst Du Dich belohnen, wenn Du endlich mit dieser einen Sache anfängst – nur für fünf Minuten?
Wenn Du magst, schreib uns, womit Du angefangen hast und wie Du Dich dafür belohnst.
Wir freuen uns, von Dir zu lesen und mit Dir zu feiern, wenn Du den ersten Schritt gegangen bist.